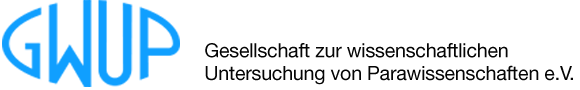Die Gerac-Akupunkturstudien
Werner Hessel
- Die Akupunktur nach den Regeln der TCM unterscheidet sich in ihren Ergebnissen nicht wesentlich von der Scheinakupunktur (Sham).
- Akupunktur ist in der klinischen Anwendungspraxis bei chronischen Kniegelenksarthrose- und Rückenschmerzen doppelt so wirksam wie eine westliche Standardtherapie.
Allerdings ist für Akupunktur-Anhänger nicht die Überlegenheit dieser Methode das Überraschende, sondern die ähnlichen Ergebnisse von Verumund Scheinakupunktur. Die Argumente: Die Verum-Akupunktur sei keine TCM-Akupunktur oder doch nur eine Minimalakupunktur gewesen und deshalb ohnehin nicht hochwertig. Die spezifische Syndromdiagnostik nach den Kriterien der TCM spielt keine Rolle. Die in der chinesischen Medizin essenzielle Lehre von der Lebensenerige sei ausgeklammert worden. Die zu wählenden Punktkombinationen seien teilstandardisiert gewesen. Es müssten Studien folgen, die die angewendete westliche Akupunktur mit der echten TCM-Akupunktur vergleichen. Die Sham-Akupunktur sei keinesfalls eine Placebo- Akupunktur, da jeder Punkt des Köpers als Akupunkturpunkt in Frage komme. Insofern seien zwei ganz ähnliche Akupunkturmethoden miteinander verglichen worden. Während es offensichtlich ist, dass Doppelverblindung bei der Akupunktur nicht möglich ist, weil der Behandler weiß (und wissen muss), was er tut, sind auch Stimmen laut geworden, die die Verblindung der Patienten in Frage stellen, weil auf den Internetseiten www.gerac.de das Studiendesign und die Lokalisation von echten Akupunkturpunkten und Sham-Punkten von Anfang an genau beschrieben wurden, sodass jeder Interessierte sich informieren konnte. In diesem Zusammenhang ergeben sich folgende weitere Fragen:
- Spielt es nicht doch eine Rolle, dass akupunkturwillige Patienten nach ihrer Rekrutierung einer Standardtherapie ohne Akupunktur unterzogen wurden und sie, da schon ebenso vorbehandelt, mit Misserfolg reagierten?
- Muss man nicht die schulmedizinische Standardtherapie der genannten Krankheitsbilder verbessern und als integrative und multimodale Therapie fachübergreifend weiterführen? (H.-R. Casser, Mainz, auf dem 29. Interdisziplinären Forum der Bundesärztekammer vom 6. bis 8.1.2005 in Berlin zum Thema „Rehabilitation bei chronischen Erkrankungen am Beispiel des chronischen Rückenschmerzes")
- Wäre dann nicht ohnehin das Fehlen schulmedizinischer Anteile wie z.B. schmerztherapeutischer Injektionen als eine verminderte Standardtherapie zu betrachten?
- Wenn das die Standardtherapie war und sie unter den bestmöglichen wissenschaftlichen Bedingungen als unterlegen ermittelt wurde, darf diese dann überhaupt noch von den Krankenkassen bezahlt werden?
- Beim Betrachten der örtlichen Verteilung der teilnehmenden Arztpraxen fällt auf, dass aus den neuen Bundesländern außer Berlin keine Arztpraxen (bis auf zwei in Brandenburg) beteiligt sind. Da bekannt ist, dass die Akupunktur auch in den neuen Bundesländern Fuß gefasst hat, was ist hierfür der Grund? Womöglich die so genannte gedeckelte Gesamtvergütung, unter der die Kassenärzte ihre Leistungen von den Krankenkassen bezahlt bekommen und die sie nicht mit neuen, unbezahlten Leistungen ausfüllen wollen?
- Welche Nebenwirkungen traten in den Studien auf?
- Könnte es sein, dass - der Eigenart der Methode geschuldet - prinzipiell kein hoher Evidenzlevel erreichbar ist? Doppelverblindung ist nicht möglich, Einfachverblindung ist fragwürdig. Placebonadelung ist umstritten, soll aber vermittels Nadeln in Plastikröhrchen bzw. nadellosen Plastikröhrchen möglich sein. Die weitere Auswertung und Veröffentlichung der Studien bleibt abzuwarten.
Literatur:
Bördlein, C. (2002): Das sockenfressende Monster in der Waschmaschine. Eine Einführung ins skeptische Denken. Alibri Verlag, Aschaffenburg.
Irnich, D.; Beyer, A. (2002): Neurobiologische Grundlagen der Akupunkturanalgesie. Schmerz 16, 93 - 102.
Gigerenzer, G. (2002): Das Einmaleins der Skepsis. Über den richtigen Umgang mit Zahlen und Risiken. Berlin Verlag, Berlin.
Hackenbroch, V. (2004): Die eingebildete Heilung. Der Spiegel 44/2004.
Haustein, K.-O.; Höffler, D.; Lasek, R.; Müller-Oerlinghausen, B.(1998): Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: außerhalb der wissenschaftlichen Medizin stehende Methoden der Arzneitherapie. A-805 Deutsches Ärzteblatt 95, 14.
Korzilius, H. (1998): „Alternative Heilmethoden". Eine Art Glaubenskrieg. Die Streitereien zwischen Anhängern der „Schulmedizin" und denen alternativer Verfahren nützen weder Ärzten noch Patienten: die Argumente der „Parteien" in charakteristischen Leserzuschriften an die Redaktion A-2075, 27. Deutsches Ärzteblatt 95, 36.
Lambeck, M. (2003): Irrt die Physik? Über alternative Medizin und Esoterik. C. H. Beck, München.
Leinmüller, R. (1996): Der lange Weg zur Anerkennung durch die Schulmedizin. A-1951 (27). Deutsches Ärzteblatt 93, 30.
Prokop, O.; Wimmer, W. (1976): Der moderne Okkultismus. Parapsychologie und Paramedizin. Magie und Wissenschaft im 20. Jahrhundert. Gustav Fischer, Stuttgart.
Schweiger, M. (2003): Medizin - Glaube, Spekulation oder Naturwissenschaft? Gibt es zur Schulmedizin eine Alternative? Zuckschwerdt Verlag, Germering.
Skrabanek, P.; McCormick, J. (1995): Torheiten und Trugschlüsse in der Medizin. Kirchheim, Mainz 1995.
Stux, G. (2004): Erste Ergebnisse der Gerac-Studie. Interpretation, Diskussion und Bewertung. http://www.akupunktur-aktuell.de/2004/beitrag12-02-1.htm
Dr. Werner Hessel arbeitet als Arzt für Allgemeinmedizin in Beeskow.
Weitere Links zum Thema
- http://www.aok-bv.de/gesundheit/themen/alternativ/index_03204.html
- http://www.aok-bv.de/gesundheit/themen/alternativ/index_03203.html
- http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=32190
- http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=34579
- http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=34581
- http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=34582
- http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=34580
- http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=34583
- http://www.aerztlichepraxis.de/aktuell/artikel/1097482440/allgemeinmedizin/schmerz?false_pw=true
- http://www.agtcm.de/index.asp?ID=1&Sort=01&PR_ID=9
- http://www.biosaffair.de/archiv/akupunktur-kreuzschmerzen.html
- http://www.evibase.de/texte/sz/texte/raetselhafte_stiche.htm
- http://www.gerac.de
- http://www.lifeline.de/special/akupunktur/cda/pageframe/0,5572,8-16276,00.htm
- http://www.medizin-aspekte.de/index.htm?/1204/alternativ/akupunktur.html
- http://www.multimedica.de/public/html/hosmm/INnew/OPFIN000X/05_aktuell/04_news/0027.html
- http://www.nzz.ch/2004/11/03/ft/page-article9YOWX.html
- http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,224038,00.html
- http://www.spiegel.de/spiegelspecial/0,1518,325443,00.html
- http://www.wettig.de
Dieser Artikel erschien im "Skeptiker", Ausgabe 1/2005.